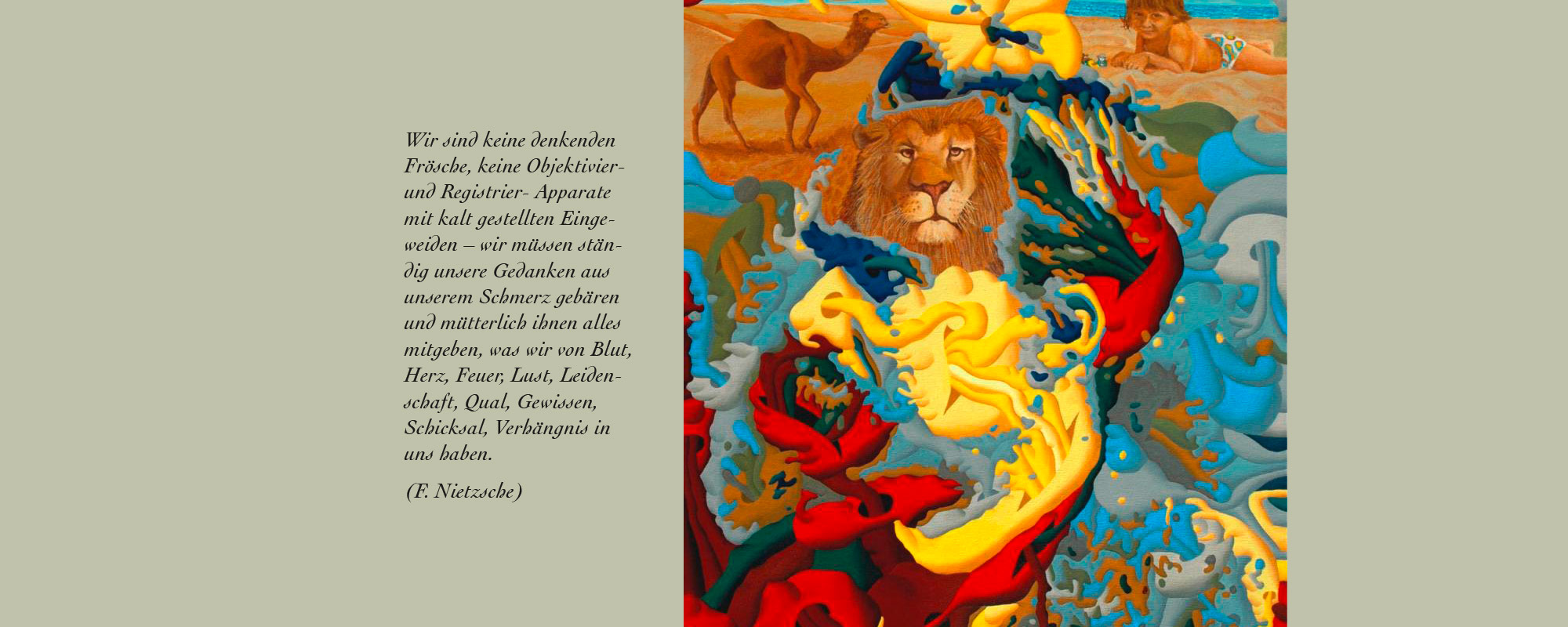Wir leben in bewegten Zeiten. Kriege werden geführt, Hass gegen Fremde geschürt, Wahlen werden mit populistischen Sprüchen gewonnen und politisch umgesetzt. Fakten zählen in Zeiten aufgewühlter Gefühle nicht mehr. Das Wort des Jahres 2016 lautet: «post-faktisch» (engl. post-truth) – ein Kunstwort, so die Definition der Gesellschaft für deutsche Sprache, das darauf verweist, dass es zunehmend um Emotionen anstelle von Fakten geht und ein Teil der Bevölkerung bereit ist, auf den Anspruch von Wahrheit zu verzichten, Tatsachen zu ignorieren und offensichtliche Lügen zu akzeptieren. Welche Dynamiken treiben den Menschen in der Art eklatante Widersprüche? Welche besonnenen Analysen und welche Handlungen helfen aus diesen Nöten heraus? Mit unserer diesjährigen Fachtagung möchten wir auf den grundlegenden Bezug aufmerksam machen, der, wenn er verloren geht, Essentielles der conditio humana preisgibt: Den Leib-Seele-Zusammenhang. Nietzsche formuliert drastisch: «Wir sind keine denkenden Frösche, keine Objektivier- und Registrier-Apparate mit kalt gestellten Eingeweiden – wir müssen ständig unsere Gedanken aus unserem Schmerz gebären und mütterlich ihnen alles mitgeben,
Jahrestagung 2017:
«Wer hören will muss spüren»
Über eine Leib-haftige Psychiatrie und Psychosomatik
Donnerstag, 22. Juni 2017, Privatklinik Oberwaid/SG – Anmeldefrist verlängert bis 19. Juni 2017
Liebe Tagungsteilnehmer
was wir von Blut, Herz, Feuer, Lust, Leidenschaft, Qual, Gewissen, Schicksal, Verhängnis in uns haben» (in: «Die fröhliche Wissenschaft» (1882)).
Das sind starke und anschauliche, aber auch klare und spürbare Worte. – In unserer Zeit pointierte David Richard Precht: «Nicht unsere Gedanken, sondern unsere Gefühle sind der Klebstoff, der uns zusammen hält.» (in: «Wer bin ich – und wenn ja, wie viele?» (2007)). Haben wir die Kraft, Zumutungen, Ängste, Gefühle und Qualen zuzulassen? Können wir diese aushalten? Vermögen wir, in diesen Dynamiken – mal mehr, mal weniger – souverän zu leben? Oder verlieren wir die Contenance als Fachkollege (vgl. Jan Kalbitzer, in: DER SPIEGEL vom 03.12.2016)? Eine lebendige Rückbindung an Gefühltes und Gedachtes scheint Not wendend, um mit unserem Aussen- und Innenleben wieder ins Lot zu kommen. Wenn Nietzsche in der genannten Vorrede mahnt: «Es steht uns Philosophen nicht frei, zwischen Seele und Leib zu trennen» – wie sehr sind dann wir, als Menschen, insbesondere als Psychiater, Psychotherapeuten, Psychosomatiker und Seelsorger, damit erinnert und ermahnt, diese wechselseitige, innig-verwobene Beziehung zu respektieren und wertzuschätzen?
Wie sehr liegt uns an diesen Zusammenhängen? Wie sehr kümmern wir uns im beruflichen Arbeiten, in Kliniken oder Praxen, aber auch im gesellschaftlichen Leben wie im Privaten darum? Eine Leib-haftige Psychiatrie, eine Leib-haftige Psychotherapie wie auch eine Leib-haftige Psychosomatik, sollte sich durch unsere je eigene Persönlichkeit mehr Gehör und Anschauung verschaffen. Diese Leib-Haftigkeit, das referentielle Sein im Leib, sollte von uns spürbarer und für uns verständlicher werden können, damit wir besser hören und verstehen, was wir spüren und so gefestigter leben – für uns und andere zum Guten. Körperliche und seelische Empfindungen führen gemeinsam zu einem einheitlichen Erleben, bei dem der empfindende und denkende Mensch Korrespondenzen und Resonanzen erfährt, welche ihn – in sich und so auch im Umgang mit anderen – gefestigt, d. h. getröstet sein lassen, gerade in dieser auch aktuell wieder so trostbedürftigen Welt.
Eine anregende Tagung wünscht im Namen des OGP-Vorstandes Christian Präckel-Stein, OGP-Präsident
Unsere Referenten zur OGP-Tagung am 22. Juni 2017

Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz (Bild: Wikipedia), geboren 1945 in Oberwappenöst/Oberpfalz (D), 1965–1971 Studium der Philosophie, Neueren Germanistik und Politischen Wissenschaft an den Universitäten München und Heidelberg, 1971 Promotion summa cum laude an der LMU München, 1975-1984 Studienleiterin auf Burg Rothenfels am Main, 1979 Habilitation in München in Philosophie, Gastprofessuren: 1987/88 an der Universität Bayreuth, 1988 Lehrauftrag an der Universität Tübingen, 1988/89 an der Katholischen Universität Eichstätt, 1995 an der Universität Erfurt, 2007 an der Università di Trento (Italien), 1989-1992 Professorin für Philosophie an der Pädagogischen Hochschule Weingarten (D), 1996 Dr. theol. h. c. an der Theologisch-Philosophischen Hochschule Vallendar (D), 1993–2011 Lehrstuhl für Religionsphilosophie und vergleichende Religionswissenschaft an der Technischen Universität Dresden (D). Seit 2011 Vorstand des Europäischen Instituts für Philosophie und Religion (EUPHRat) an der Phil.-theol. Hochschule Benedikt XVI., Stift Heiligenkreuz (A). Vizepräsidentin und Mitbegründerin der Edith Stein Gesellschaft Deutschland, Vizepräsidentin der Gertrud von le Fort Gesellschaft, Kuratorin der Robert Bosch Stiftung Stuttgart, Mitglied im Vorstand der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft Darmstadt, Vorsitzende des Freundeskreises Mooshausen e. V., mehrfach Direktorin des Philosophischen Instituts der TU Dresden. 2000-2014 Wissenschaftliche Leitung der Edith Stein Gesamtausgabe in 27 Bänden (ESGA), Verlag Herder/Freiburg (D). Seit 2005 Mitherausgeberin der Gesamtausgabe Romano Guardini in 29 Bänden, Verlag Morcellliana/Brescia. Seit 2014 Mitglied der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste (Salzburg), Klasse: Religionswissenschaft.
Hans Hermann Ehrat, geb.1938 in Lohn/SH (CH), Studium der Medizin in Zürich und Wien, Staatsexamen 1962 in Zürich, Dissertation «Insulinproduzierende Pankreastumoren» (Prof. Ludin/Radiologie-Basel), Ausbildung zum Facharzt Allgemeine Medizin FMH im Kantonsspital Schaffhausen und in der Kinderklinik St. Gallen. 1971 Eröffnung Hausarztpraxis in Neuhausen am Rheinfall/SH. 1985 Ausbildung «idiolektische Gesprächsführung» in Zürich und Würzburg (Prof. Dr. A. D. Jonas). Lehrtätigkeit bei der Gesellschaft für «Idiolektik und Gesprächsführung» in Würzburg, Seminarleiter in Wien, Berlin, München und Schaffhausen; Supervisor und Lehrtherapeut; Dozent an den Palliativakademien in Würzburg und Bamberg.

Thomas Knecht (Bild: srf.ch), geboren 1958 in Zug (CH), Studium der Medizin an der Universität Zürich, 1983/84 Promotion zum Dr. med. Seine Weiterbildung absolvierte er in verschiedenen psychiatrischen Kliniken und Ambulatorien der Ostschweiz sowie in der Neurochirurgischen Universitätsklinik Zürich. Nach Erlangung des Facharzttitels in Psychiatrie arbeitete er als Oberarzt und ab 1993 als Leitender Arzt im Bereich Suchttherapie und forensische Psychiatrie in der Psychiatrischen Klinik Münsterlingen/TG. Seit August 2012 ist er Leitender Arzt Forensische Psychiatrie im Psychiatrischen Zentrum Appenzell Ausserrhoden in Herisau, daneben betreibt er eine psychiatrische Privatpraxis und ist als Dozent an verschiedenen Schweizer Hoch- und Fachschulen tätig.

Hildburg Porschke (Bild: oberweid.ch), Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, Fachärztin für Neurologie. Seit 2007 in der Schweiz: Zunächst Psychiatrie Münsterlingen/TG auf der Psychotherapiestation mittleres Lebensalter; 2010-2014 gemeinsam mit Frau Dr. med. Doris Straus Aufbau der Clinica Holistica Engiadina in Susch/GR; seit 2015 ebenfalls im Tandem mit Frau Dr. med. D. Straus Aufbau der Privatklinik Oberwaid/SG, 3/2015 Start der Psychosomatischen Rehabilitation in der Oberwaid, St. Gallen, Schwerpunkt Stressfolgeerkrankungen.

Roland von Känel (Bild: barmelweid.ch), geboren 1965 in Bern (CH), Studium der Medizin, 1992 Dissertation Hämatologisches Zentrallabor/Inselspital Bern. 1999-2001 Postdoctoral Fellow, Department of Psychiatry, University of California San Diego Joel E. Dimsdale, M.D (Editor-in-Chief Psychosomatic Medicine 1992-2002). Postgraduate Researcher, Department of Psychiatry, University of California San Diego. 2001-2003 Co-Leitung des verhaltensmedizinischen Labors zusammen mit Prof. Dr. med. Joachim E. Fischer am Institut für Verhaltenswissenschaft der ETH Zürich (Prof. Dr. phil. Karl Frey). Seit 2002 Regelmässige Forschungsaufenthalte an der University of California San Diego, Department of Psychiatry, als Co-Investigator und Research Consultant bei durch die U.S. National Institutes of Health/National Institute on Aging finanzierten Forschungsprojekten.
2004-2012 Ausserordentlicher Professor (Extraordinarius) für Somato-Psychosoziale Medizin, Universität Bern. 2012-2014 Ordentlicher Professor (Ordinarius) für Psychosomatische u. Psychosoziale Medizin, Universität Bern. Seit 08/2014 Titularprofessor an der Medizinischen Fakultät der Universität Bern. Seit 01/2016 Extraordinary Professor, Faculty of Health Sciences, Hypertension in Africa Research Team (HART), North-West University, Potchefstroom Campus, South Africa.
2004-2014 Chefarzt Kompetenzbereich für Psychosomatische Medizin, Universitätsklinik für Allgemeine Innere Medizin, Universitätsspital Bern (Inselspital). Seit 8/2014 Chefarzt Psychosomatische Medizin, Psychiatrie und Psychotherapie, Departement Psycho-somatische Medizin, Klinik Barmelweid/AG (CH).
Seit 2004 Mitglied Psychokardiologie Board, Präventive Kardiologie und Sportmedizin, Universitätsklinik für Kardiologie, Inselspital Bern. Seit 2007 Mitglied «Scientific Board Committee» der Swiss Inflammatory Bowel Disease Cohort Study. 2007-2013 Mitglied im Leitenden Ausschuss für den Masterstudiengang
in Psychotraumatologie (Master of Advanced Studies in Psychotraumatology MAS–PT) an der Universität Zürich. Seit 2013 Wissenschaftlicher Beirat für den Diplomstudiengang in Psychotraumatologie (Diploma of Advanced Studies in Psychotraumatology DAS–PT) an der Universität Zürich. 2009 Visiting Professor: University College London, Department of Epidemiology and Public Health, Psychobiology Group; Prof. Andrew Steptoe, DSc, DPhil. Seit 2010 Leiter der Forschungsgruppe Psychosomatik (Neuropsychosomatik und Stressbiologie) am Departement für Klinische Forschung der Universität Bern. Seit 2014 Gastwissenschaftler an der Universitätsklinik für Neurologie, Inselspital Bern. Seit 2015 Mitglied Wissenschaftlicher Beirat Kurhotel & Privatklinik Oberwaid, St. Gallen (CH).
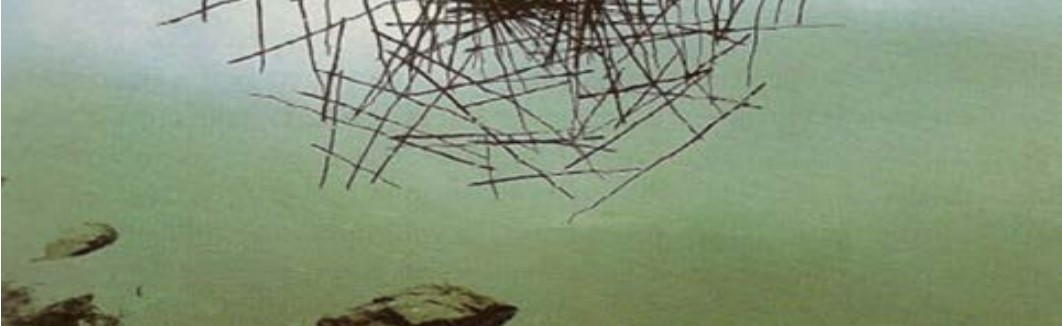
Gedanken zum Thema einer Leib-haftigen Psychiatrie und Psychosomatik – «Das Seelische und unmittelbar politische Folgen»
«Menschen leben immer in Beziehungen, noch bevor sie handeln» (Klaus Dörner/Ursula Plog). Die Grundschwierigkeiten von uns Menschen sind bedingt durch Störungen von Begegnungs- und Beziehungserfahrungen. Diese zu lindern und zu überwinden ist eine Kernaufgabe in unserer Arbeit. Es gelingt uns wohl erst dann recht, wenn wir den Charakter von Begegnungen als Wechselbeziehungen begreifen und verstehen, die zwischen zwei Subjekten, die sich einander auch zu Objekten machen können, geschehen. Im letzten Fall, so Dörner und Plog, «lasse ich die Begegnungsangst nicht an mich heran, lasse mich innerlich nicht davon berühren, wehre ab.» Im Erstgenannten «lasse ich die Begegnungsangst in mich hinein, lasse mich vom Anderen anrühren, in Frage stellen, schwinge mit, lasse den Anderen mit mir etwas machen. Also habe ich nicht nur meine neue Umgebung wahrzunehmen, sondern auch mich in ihr und mich in mir. Zur Wahrnehmung kommt die Selbstwahrnehmung.» Dörner und Plog fügen diesem Gedankengang hinzu: «Da jedes Psychiatrische Handeln modellhaft wirkt, muss in ihm das sichtbar werden, was erreicht werden soll.»
(Bezeichnenderweise beginnen Dörner und Plog ihr Lehrbuch der Psychiatrie und Psychotherapie «Irren ist menschlich», im ersten Abschnitt «Gebrauchsanweisung» mit einem Paul Celan-Zitat: «Ich bin Du, wenn ich ich bin»)
Jan Kalbitzer, Psychiater und Psychotherapeut, Leiter des Zentrums für Internet und Gesundheit an der Berliner Charité, schrieb ein Essay, in welchem er der Frage nachgeht: «Wozu Psychiater lieber schweigen sollten» (DER SPIEGEL Nr. 49 vom 03.12. 2016). Der Autor kritisiert nicht nur psychiatrische Diagnosen «aus der Ferne», etwa über den US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump, sondern auch Auftritte von Psychiatern bei öffentlichen Gesprächsrunden (Manfred Spitzer in der ARD-Sendung «Anne Will» am 30.10.2016): «Grundsätzlich kann man sagen, dass ein psychiatrischer Experte nur so lange einer ist, wie er nicht vorschnell urteilt oder die Contenance verliert. Dann kann er immer noch eine Privatperson mit einer wichtigen Meinung sein.
Aber in dem Moment, in dem er sich seinen Gefühlen hingibt oder gar dem Bedürfnis nach schneller Aufmerksamkeit, gibt er seine therapeutische Urteilskraft auf.» Ist es wirklich so, wie der Berliner Kollege schreibt? Sind Gefühle zu meiden oder zu suchen? Stimmt auch eine weitere Aussage von ihm: «In unserer Ausbildung lernen wir eine wichtige Fähigkeit: unsere eigenen
inneren Dämonen wie Eitelkeit, Geltungssucht, Angst und übertriebene Wut zu erkennen und aushalten zu können.»? Wenn schon Psychiater als sogenannte Fach-Experten trotz ihrer Ausbildung damit Schwierigkeiten haben, wie sehr mag dies für andere Menschen zutreffen, oder gar für Menschen mit öffentlichen Ämtern? Was ist zu sogenannten «Wutbürgern» (Wort des Jahres 2010) anzugeben? Was zu Menschen, die (weltweit) populistischen Wahlkandidaten ihre Stimme geben? Was fehlt dem Menschen zu einem besonnenen Dasein und Miteinander, mit Eigenem und Fremden? Was tun, wenn Psychiater es auch nicht wissen und darüber unsicher oder ängstlich sind? Welchen Beitrag können wir in diesen Zeiten leisten?
Wir leben, weil wir leiben. Aber wieso nur ist dieser Zusammenhang so ungewohnt, so abseits, gar so verdächtig? Kann es wirklich so schlicht heissen, wie Kalbitzer es rät, wir sollten uns auf den Weg machen, den Gefühlen zu trauen, so würden uns schon jene Kräfte zuteil, die uns zum Gelingen brächten? Kann es so einfach sein? Können Gefühle nicht auch in die Irre führen? Es bedarf wohl eher differenzierender Anstrengungen. Im Jahr 1978 schrieb Joseph Weizenbaum, Prof. für Computerwissenschaften am Massachusetts Institute of Technology (MIT): «Um ein Ganzes zu werden, muss der Mensch auf immer ein Erforscher seiner äusseren und inneren Realitäten sein. Sein Leben ist voller Risiken, die er jedoch mutig auf sich nimmt, weil er wie der Forscher lernt, seinen eigenen Fähigkeiten zu vertrauen, durchzukommen und auszuhalten.»
In Zeiten mit Ängsten vor Terroranschlägen, nationalistischen Tendenzen, gesellschaftlichen Medialisierungen und zunehmenden Digitalisierungen unserer Alltagswelt, also in Zeiten, in denen es um die Besinnung auf das Wesentliche des Menschseins geht, scheint besonders das notwendig, was zentraler Gedanke von Arno Gruen war: «Vielleicht sollten wir den Unterschied zwischen Identität und Identifikation deutlich machen, indem wir erkennen, dass Identifikation nicht die Basis für eine eigene Identität bildet. Dass Identifikation und Identität einen Widerspruch in sich bergen, weil Identifikation eben nicht zur Entwicklung einer autonomen, originären Identität führt». Der gängige, kriegerische Begriff von Autonomie beruhe, so Gruen, auf einer auf Abstraktionen aufgebauten Idee des Selbst, das, um die eigene Wichtigkeit und Unabhängigkeit zu behaupten,
seine Gefühle abspaltet und dessen vermeintliche Freiheit sich in dem Zwang erschöpfe, sich und anderen ständig Beweise der Stärke und Überlegenheit liefern (zu) müssen. Gelingende Autonomie sei dementgegen derjenige Zustand, in dem ein Mensch in voller Übereinstimmung mit seinen eigenen Gefühlen und Bedürfnissen ist. Ich bin der Auffassung, dass wir weder die Empfindlichkeit über die Vernunft erheben, noch den Verstand der Empfindlichkeit vorziehen sollten. Eine schlüssige Verbindung zwischen Beidem (und eben keine Vereinseitigung oder die Ausspielung des Einen gegen das Andere) erscheint notwendiger denn je. So mag Arno Gruen hier lediglich darin ergänzt werden durch den Hinweis, es komme in der Wahl auf eine Entscheidung zum Guten hin an.
In einem «Einwurf» zum Attentat auf den Weihnachtsmarkt in Berlin geht die Journalistin Elke Schmitter der Frage nach «Warum wir kühl auf den Terror reagieren sollten (DER SPIEGEL Nr. 52 vom 23.12.2016).
Ihr Text trägt den Titel: «Stiff upper lip», eine englische Redewendung (keep a stiff upper lip), die besagt, die Bewahrung einer festen (steifen) Oberlippe könne der Ausdruck einer Selbstdisziplin sein, mit der sich ein Mensch weder seine Verletzlichkeit noch überschwängliche Freude anmerken lasse. Die «Flut der Anteilnahme im sozialen Raum» sei ihr nicht wegen einer «stillen Geste», einem «Blumenstrauss oder Kerze am Ort des Geschehens» unheimlich, aber «als eine Artikulation des Mitleidens, das die Grenzen des Ichs aufzuheben scheint, das regressiv mitschwimmt in einem Ozean des Schocks, der Angst, der Beschwörung von Traurigkeit.» Als «das rettende Ufer» sieht sie das «Mitgefühl für die unmittelbar Betroffenen. Als etwas, was ins Privatleben gehört. Im öffentlichen Leben aber sollte gelten: stiff upper lip.»
In unserer Macht stehe «wohl aber die Frage, wie wir uns zu dieser Bedrohung verhalten.» Die Autorin wünscht sich «Haltung, Würde und die Aufrechterhaltung des Unterschiedes zwischen dem Opfer und dem Nicht-Opfer. Und alles andere, was Pragmatik befördert und Hysterie verhindert.» Dazu zitiert sie den Psychiater Viktor Frankl: «Zur Fähigkeit des Menschen, über den Dingen zu stehen, gehört nun auch die Fähigkeit, über sich selbst zu stehen. Ich muss mir von mir selber nicht alles gefallen lassen.» Das mag pointiert erscheinen, hat jedoch etwas Zutreffendes. Stehen aber jene, die ganz in Angst, Panik und Hysterie aufgehen, nicht auch über sich selbst? Könnte es nicht eher so benannt werden, dass erst jener Mensch, welcher sich und seine Gefühle und Gedanken kennt und beherrscht, er also in sich ruht, er innerlich gefestigt ist, zu der genannten Fähigkeit der Selbst-Beherrschung in der Lage ist und so angemessen, auch in äusseren Notsituationen, verantwortungsvoll zu reagieren weiss?
Muss der Mensch sich von sich selber befreien, muss er dazu sich fremd werden, um dies leisten zu können? Wohl eher nicht. Denn wie sollten wir mit anderen friedlich leben, wenn wir selber mit uns friedlos sind? Wäre dies nicht ein wahrer Un-Sinn, eine Ver-Rücktheit? Wie kann es dem Menschen gelingen, bei sich zu sein, sich zu besinnen und für sich, wie für andere, das Richtige zu tun? Dem Anspruch des Anderen an mich (E. Levinas) ist ebenso zu genügen, wie dem Streben nach Trosthaftigkeit, also der eigenen inneren Festigung, denn es gilt wohl: Nur wer bei sich ist, kann von sich absehen. Dann können wir Menschen Eigen- und Fremdverantwortung zugleich leben (Wie global und persönlich aktuell dies ist, zeigt Timothy Snyder in seinem Buch «Über Tyrannei – zwanzig Lektionen für den Widerstand» (C.H.-Beck, 2017) – dieser kann im Äusseren gelingen, wenn dazu auch die Innere Klarheit und Festigkeit gegeben ist).
Gefühl und Verstand. Beides gilt es zu integrieren – für ein Leib-haftiges Seelenleben! (Christian Präckel-Stein, Mai 2017)